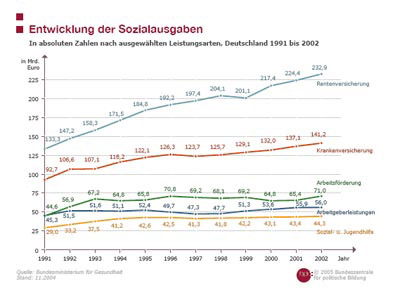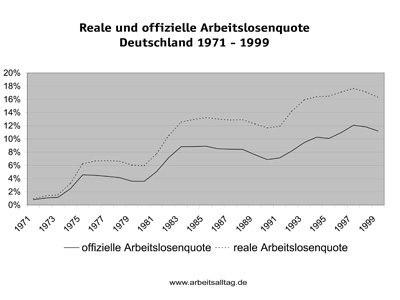Der historisch-systematische Kontext der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von Karl Marx[1]
von Rubens Enderle
I
Bereits wenige Jahre nach der Veröffentlichung der Grundlinien der Philosophie des Rechts[2] im Jahr 1820 kam der Hegelschen Staatstheorie für die politische Debatte innerhalb Deutschlands eine erhebliche Bedeutung zu. Die in zwei Gruppen geteilten Schüler Hegels – die Jung- bzw. Linkshegelianer und die Alt- bzw. Rechtshegelianer – entfesselten einen aufgeregten Streit um die politisch-theoretische Erbschaft des Meisters. Es handelte sich hauptsächlich um die Interpretation des Themas der Versöhnung des Vernünftigen mit dem Wirklichen. Für die Junghegelianer ging es um den Beweis, dass das Wirkliche nicht unmittelbar mit dem empirisch-positiv Bestehenden identifiziert werden dürfe, sondern durch die Arbeit des Negativen vermittelt auf eine höhere Stufe des Begriffs gehoben werden müsse. Damit verfolgten die Junghegelianer die – theoretische – Absicht, der Hegelschen Staatstheorie ihren humanistischen, emanzipatorischen Inhalt zurückzugeben. Praktisch bemühten sie sich als journalistisch Tätige um die Verwirklichung dieses vernünftig-begrifflichen Inhalts: Sie propagierten die Überführung der nach wie vor absolutistischen preußischen Monarchie in eine zumindest konstitutionelle Monarchie, wobei sie zunächst nicht offen demokratische Positionen vertraten. In diesem Bestreben sind sie seit 1841 noch bestärkt worden, als sich nämlich herausstellte, dass die von Friedrich Wilhelm IV. initiierte Verfassungsreform allenfalls ein halbherziger Kompromiss war. Die konstitutionelle Monarchie war nicht einmal ein Ausgleich zwischen den Interessen des (Feudal-) Adels und den Reformkräften, so dass die Junghegelianer sich gedrängt sahen, der Hegelschen Staatstheorie zugunsten einer Propagierung demokratischen Gedankenguts den Rücken zu kehren.
Obwohl Marx dem junghegelianischen Denken damals nahe stand, gab es doch auch gravierende Differenzen. Anfang 1841, anläßlich seiner Doktorarbeit, denunzierte er die Kritiker Hegels als „moralisch“ und „unphilosophisch“, wenn sie sich polemisch über Hegels sogenannte „Akkommodation“ äußerten. Sie vertraten irrtümlicherweise die Ansicht, Hegel habe sich aus taktischen Gründen und Opportunitätsrücksichten den politischen Gegebenheiten angepaßt und vergaßen darüber, dass Hegel – philosophisch gesprochen – in einem „unmittelbaren, substantialen, sie (hingegen, R.E.) in (einem, R.E.) reflectirten Verhältniß zu seinem System standen“. Anders gesagt, Hegels Fehler war der seines Systems und eben keine persönlich motivierte Vorsichtsmaßregel eines Ängstlichen. Eine wirkliche philosophische Kritik hätte Marx zufolge also folgendes zu leisten gehabt: zu demonstrieren, dass „die Möglichkeit dieser scheinbaren Accomodationen in einer Unzulänglichkeit oder unzulänglichen Fassung seines Princips selber ihre innerste Wurzel hat“, oder, noch prononcierter, dass die als eigentlich systemfremd beanstandete Akkommodation ans Bestehende das Prinzip der Philosophie Hegels sei. Also habe man die innerliche Entwicklung von Hegels Denken, seine ureigene Logik offenzulegen, die, metaphorisch gesprochen, „bis an deren äußerste Peripherie sein eigenstes geistiges Herzblut hinpulsirte“. Diese Rekonstruktion könne aber, ihrer Befangenheit wegen, keine moralisch fundierte Kritik leisten, sondern bloß eine, die am „Fortschritt des Wissens“ ihr Maß habe; die Rede ist von immanenter Kritik. „Es wird nicht das particulare Gewissen des Philosophen verdächtigt, sondern seine wesentliche Bewußtseinsform construirt, in eine bestimmte Gestalt und Bedeutung erhoben, und damit zugleich darüber hinausgegangen“.[3] Anstelle des mißbilligenden Deutens auf sogenannte Unzulänglichkeiten Hegelschen Denkens habe die wahre Kritik sie aus ihrem Grund heraus zu begreifen und damit an ihnen selbst als unwahr zu widerlegen.
Diese erste Marxsche Erklärung des Begriffs der „philosophischen Kritik“ ist 1842 in einen Artikel der Rheinischen Zeitung wiederaufgenommen und weiter entwickelt worden. In einer Art Glosse gegen die Historische Rechtsschule und ihren Vorläufer Gustav Hugo demonstrierte Marx den in Wahrheit romantischen Hintergrund von Hugos vermeintlichem Kantianismus und sprach in diesem Zusammenhang von einem „Betrug“. Darüber hinaus verglich er die „gemeine Skepsis“ der Historischen Rechtsschule mit der „Skepsis des achtzehnten Jahrhunderts“, d.h. mit der skeptischen Note der durch Kant beeinflußten und ins Subjektive modifizierten Aufklärungsphilosophie. Während die Skepsis der Historischen Rechtsschule den Schein von Rationalität nur deswegen kritisiert, um sich dem bloß Positiven nur umso bedingungsloser auszuliefern, sucht die aufgeklärte Kritik das hinter diesem Schein verborgene Wesen sichtbar werden zu lassen. Dieses Wesen gibt sich dem geschichtlich geübten Blick als die „Loslösung des neuen Geistes von alten Formen, die nicht mehr werth und nicht mehr fähig waren, ihn zu fassen“, zu erkennen. Hier kann man einerseits mutmaßen, dass es sich um eine hegelianisierende Interpretation der Kantischen praktischen Philosophie handelt. Allerdings sollte man sich andererseits nichts vormachen: Marx vertritt keinesfalls einen Moralismus, dessen Spezifikum es ist, die Historie an noch dazu apriorischen Sollensmomenten zu blamieren. Nicht um eine abstrakte Idee der Vernunft, nicht um das Kantische Noumenon eines subjektiven Geistes geht es ihm, sondern darum, den Begriff der in sich notwendigen geschichtlichen Entwicklung zu erfassen. Die Skepsis des 18. Jahrhunderts zertrümmerte bloß das Zertrümmerte, verwarf das ohnehin Verworfene. Der „neue Geist“ hingegen befreite sich von den „alten Formen, die dank der eigenen Entwicklung dieses Geistes nicht mehr fähig waren, ihn zu fassen“. Kantisch an diesem durch Hegel vermittelten Standpunkt ist allenfalls noch die insgesamt aufklärerisch-kritische Grundeinstellung bei Marx. Ohne eine auch praktisch werdende Kritik gibt das „Verworfene“ dem „neuen Leben“ keinen Raum, der „neue Geist“ bleibt an die „alten Formen“ gebunden und man wird Zeuge der „Verfaulung“ einer Welt, die sich in diesem Zerfallsprozess „selbst genießt“.[4] Die Kritik, so läßt sich zusammenfassend sagen, ist keine, die die Welt an einer externen Rationalität blamieren möchte, sondern sie selbst ist nichts weiter als eine rationale Betrachtung geschichtlicher Abläufe, sozusagen deren Selbstbewusstwerden, wodurch, so die Unterstellung, der Boden bereitet wird für die Verwirklichung wahrer Rationalität.
In dem Manuskript Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie (ZKhR) und dem Briefwechsel von 1843, der 1844 in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern veröffentlicht wurde, gibt Marx der Idee der „philosophischen Kritik“ ihre endgültige Gestalt. In der ZKhR kontrastiert er sie sowohl dem spekulativen Dogmatismus Hegels als auch dem „entgegengesetzten, dogmatischen Irrthum“ der „vulgären Kritik“, d.h. derjenigen der Berliner Gruppe der Freien, deren wichtigste Mitglieder Bruno Bauer und Max Stirner waren. Die „vulgäre Kritik“ nimmt in Hinblick auf die empirische Wirklichkeit eine arrogante Haltung ein. Sie befaßt sich mit den Widersprüchen des Bestehenden nur deswegen, um, in intellektuellem Hochmut, alles Reale und die in ihr beheimatete menschlich-sinnliche Praxis inklusive der sogenannten „Masse“ verachten zu können. Beschäftigt sich die „vulgäre Kritik“ beispielsweise mit der Verfassungsfrage, dann macht sie lediglich „auf die Entgegensetzung der Gewalten aufmerksam etc.“ und „findet überall Widersprüche“. Sie ist „selbst noch dogmatische Kritik, die mit ihrem Gegenstand kämpft, so wie man früher etwa das Dogma der heiligen Dreieinigkeit durch den Widerspruch von 1 und 3 beseitigte“. Die „wahrhaft philosophische Kritik der jetzigen Staatsverfassung“ dagegen „faßt“ die Widersprüche „in ihrer eigenthümlichen Bedeutung“, „begreift ihre Genesis, ihre Nothwendigkeit“, und „zeigt die innere Genesis der heiligen Dreieinigkeit im menschlichen Gehirn“.[5]
Kurze Zeit später, in einem Brief vom September 1843, behauptet Marx, dass die „kritische Philosophie“ sich auf zwei Bereiche erstrecken müsse: den des Theoretischen von Religion und Wissenschaft und den des Praktischen der Politik. Ihre Aufgabe sei die „Reform des Bewußtseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysirung des mystischen sich selbst unklaren Bewußtseins, trete es nun religiös oder politisch auf“. Das Thema des „Selbstbewusstseins“ nimmt also immer noch einen zentralen Platz im Marxschen Denken ein. Das Neue im Vergleich zu den anderen Texten besteht hier allerdings in einem merklichen Einfluss Feuerbachs, der im Februar 1843 die Vorläufigen Thesen zur Reformation der Philosophie veröffentlicht hatte. Marx schreibt an Ruge: „Unser ganzer Zweck kann in nichts anderem bestehn, wie dies auch bei Feuerbachs Kritik der Religion der Fall ist, als daß die religiösen und politischen Fragen in die selbstbewußte menschliche Form gebracht werden.“[6] Es handelte sich letztlich darum, die Kritik über die Grenzen des Feuerbachschen Denkens hinauszuführen, da dieses in dem engen theoretischen Rahmen der Religion und Wissenschaft gefangen war. Zu bedenken freilich bleibt auch: Die Feuerbachsche Anthropologie wird dennoch zum entscheidenden Vorbild für die Marxsche Kritik an Hegels Philosophie.
II
Mit der Waffe der Kritik ausgerüstet war Marx für seine Abrechnung mit der Staatsphilosophie Hegels gewappnet. Seit Ende 1841 hatte er angefangen, an einem gegen die Philosophie Hegels – besonders gegen seine Theorie des Staates – gerichteten Artikel zu arbeiten. Im März 1842 verspricht er Ruge einen Text zu liefern, dessen Kern „die Bekämpfung der constitutionellen Monarchie als eines durch und durch sich widersprechenden und aufhebenden Zwitterdings“[7] sei. Diesen Beitrag, der in den Deutschen Jahrbüchern oder in den Anekdota hätte erscheinen sollen, blieb Marx schuldig, was auf seine immer intensivere Mitarbeit – zuerst als Beiträger, ab Oktober 1842 als Chefredakteur – an der Rheinischen Zeitung zurückgeführt werden kann. Außerdem wurde ihm wohl bewusst, dass diese praktisch-politisch motivierte Tätigkeit ihn zu einer Auseinandersetzung mit Problemen führte, deren Lösung eine tiefere Untersuchung der bestehenden materiellen Verhältnisse verlangte. Die seit Oktober 1842, seit seiner Arbeit als Redakteur der Rheinischen Zeitung zu konstatierende progressive Radikalisierung der Marxschen Kritik war auch verursacht durch seine Unzufriedenheit hinsichtlich seiner eigenen Einschätzung der Hegelschen Rechtsphilosophie. Retrospektiv hat er diesen Zusammenhang 1859 in der Vorrede Zur Kritik der politischen Ökonomie notiert: „Im Jahr 1842-43, als Redakteur der ‚Rheinischen Zeitung‘, kam ich zuerst in die Verlegenheit über sogenannte materielle Interessen mitsprechen zu müssen“. Marx beschloss, sich von „der öffentlichen Bühne in die Studierstube zurückzuziehn“, und fährt dann fort: Die „erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, war eine kritische Revision der Hegel’schen Rechtsphilosophie“.[8]
Die namhaft gemachte Berücksichtigung der „materiellen Interessen“ kommt dann bereits in den im Oktober und November 1842 in der Rheinischen Zeitung veröffentlichten Artikeln Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz zum Zuge. Hier ergreift er Partei für die Interessen der verarmten Teile der Bevölkerung, denen selbst das Sammeln des trockenen, von den Bäumen gefallenen sogenannten ‚Raffholzes‘ verboten worden war. Die bedingungslose Subsumtion des Einzelnen unter die Allgemeinheit des Staates und das verabsolutierte und keine Ausnahmen duldende Recht des Privateigentums wird scharf kritisiert. Dem zum Handlanger des Privateigentums pervertierten Staat wird die Idee eines Staates kontrastiert, der sich vor allem auch der Interessen der verarmten Klasse anzunehmen hätte. Dessen Gewohnheitsrecht, die gemeinsten Bedürfnisse des menschlichen Lebens zu befriedigen, werde ihm durch das Recht auf Privateigentum ganz prinzipiell streitig gemacht.
Eine eigentümliche Mischung von Moral und Kritik bestimmt Marx‘ Argumentation. Das Holzdiebstahlsgesetz setzt diejenigen ins Unrecht, die, aus purer Not, sich an dem Recht auf Privateigentum vergreifen. Anstatt nun aber gegen einen Staat zu polemisieren, der prinzipienfest die Drangsale der von seiner Gesetzgebung unmittelbar Betroffenen missachtet, erteilt Marx ihm überraschenderweise einen Rat: des „instinktiven Rechtssinns“ seiner verarmten Klasse eingedenk zu sein, sprich, den Gerechtigkeitssinn derselben zu instrumentalisieren, um sie so zur wirklichen Teilnahme am Gemeinschaftsleben zu motivieren.[9] Das institutionalisierte Elend wird politisiert und ausgerechnet einem Staat, der das Sterben gerade erst legalisiert hat, wird angetragen, er möge auch die positiven und legitimen Eigenarten der Sitten der Armen, zu denen eben das Holzsammeln gehört, juristisch anerkennen. Nichts ist leichter und vor allem, in des Wortes doppelter Bedeutung, billiger zu haben als das: Die Eingemeindung der Paupers in den gemeinsamen Wertehimmel.
Immerhin, eine derart affirmative Kritik schien Marx dann doch nicht zufriedenzustellen. Ihm wurde klar, dass er – spiegelverkehrt – den wirklichen Zustand der Gesellschaft zu einer abhängigen Variablen des Rechtswesens des Staates gemacht hatte. Armut ist danach kein soziales Faktum, sondern wird aus der Abwesenheit des politischen Oberaufsehers abgeleitet, wo sie doch, umgekehrt, gerade erst durch die staatliche Gesetzgebung für rechtens erklärt worden ist. Denn genau dafür steht, darüber hinaus, das von Marx selbst geforderte Gewohnheitsrecht der armen Klasse: Es läßt, ein bloß moralisches Palliativ, die Armut innerhalb der sozialen Wirklichkeit unverändert bestehen, indem es ihr lediglich eine politisch-gesetzliche Einkleidung gibt. Die bürgerliche Gesellschaft ist und bleibt eine Klassengesellschaft mit der „Abstraktheit des Staates“ als gesetzgebendem Oberaufseher auch und gerade dann, wenn er sich des Bodensatzes der Gesellschaft rechtsförmlich in der Art annimmt, dass er seine prinzipielle Benachteiligung dadurch festschreibt, daß er ihn unter die – partikulären – Interessen des Privateigentums subsumiert. Faktisch zu kurz gekommen kann der Schein gepflegt werden, als kämen auch die Bedürfnisse der ausnahmslos Unterlegenen zu ihrem Recht. Marx hat, m.a.W., inzwischen die Akkommodation an die ontologisch untermauerte Überlegenheit des Staates selbst durchschaut, deren partieller Fürsprecher er kurz zuvor noch gewesen war.
Im philosophiehistorischen Kontext liest sich das dann als eine Art Bekenntnis etwa so: „Meine Untersuchung mündete in das Ergebniß, daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen ‚bürgerliche Gesellschaft‘ zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der ‚bürgerlichen Gesellschaft‘ in der politischen Oekonomie zu suchen sei.“[10] Marx‘ Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie ist ein Dokument des Übergangs einer zum Teil idealistischen Position eines kritischen Materialisten, der sich in den 50er Jahren endgültig den ökonomischen Fragen des Kapitals zuzuwenden begann.
III
Nach seiner Zeit bei der Rheinischen Zeitung ist Marx nach Kreuznach übergesiedelt, wo er am Vormittag des 19. Juli 1843 Jenny von Westphalen heiratete. Sie sind beide bis Oktober des Jahres in Kreuznach geblieben. Während dieser Zeit wartete Marx auf Nachrichten von Ruge, der ihn über das Datum und den Ort der Veröffentlichung der Deutsch-Französischen Jahrbücher[11], an denen Marx als Beiträger und Mitverleger mitzuarbeiten sich verpflichtet hatte, unterrichten wollte. Unterdessen studierte er die Geschichte der Französischen Revolution und die Klassiker der politischen Philosophie und nahm eine „kritische Revision“ der Hegelschen Philosophie des Rechts vor. Aus dieser Auseinandersetzung mit Hegel ging ein Manuskript von 157 Seiten hervor, in dem Marx große Teile der Grundlinien der Philosophie des Rechts – es handelt sich dabei hauptsächlich um die §§ der dritten, dem Staate gewidmeten Abteilung – abschrieb und kommentierte.[12]
Das Hauptthema der Marxschen Kritik an der politischen Philosophie Hegels ist die für die Moderne charakteristische Behauptung eines Gegensatzes zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft und der Hegelsche Versuch, diese Extreme theoretisch nach dem Vorbild der preußischen konstitutionellen Monarchie zu versöhnen. Die Marxsche Kritik gibt sich jedoch nicht damit zufrieden, die Widersprüche oder Akkommodationen Hegels lediglich zu benennen, und erschöpft sich ebensowenig in der Absicht, dem preußischen Staat die Vision eines idealen Gemeinwesens zu kontrastieren. Die „wahrhaft philosophische Kritik“ hat nach Marx vielmehr die „Genesis“ und die „Notwendigkeit“ der wirklichen Widersprüche zu erfassen, egal ob es sich um Widersprüche des preußischen Staates, des modernen Staates oder der Hegelschen Philosophie handelt. Die Widersprüche der Hegelschen Philosophie werden aus ihr selbst heraus erklärt, d.h. aus den ontologischen Voraussetzungen der Hegelschen Spekulation, die den zentralen Gegenstand der Marxschen Kritik bildet. Erst auf der Grundlage der Kritik der spekulativ-logischen Voraussetzungen kommt Marx zu dem hieraus abzuleitenden speziellen Fall der Hegelschen Staatsauffassung.
Die Kritik der Spekulation, womit das Manuskript beginnt, ist eine grundsätzliche, wenn man so will, ontologische Kritik. In dem § 262 bestimmt Hegel den Staat als die „wirkliche Idee“, als den „Geist, der sich selbst in die zwei ideellen Sphären seines Begriffs, die Familie und die bürgerliche Gesellschaft, als in seine Endlichkeit scheidet (…)“. Familie und bürgerliche Gesellschaft sind laut Marx „das Treibende“, die „conditio sine qua non“, die „Voraussetzungen“ des Staates: „Das Faktum ist, daß der Staat aus der Menge, wie sie als Familienglieder und Glieder der bürgerlichen Gesellschaft existire hervorgehe“. Spekulatives Denken spricht jedoch dieses Faktum „als That der Idee“ aus, „nicht als die Idee der Menge, sondern als That einer subjektiven von dem Factum selbst unterschiedenen Idee“, und verleiht ihm dadurch eine logisch-vernünftige, von der realen Tatsache unabhängige und verselbständigte Form. Die empirische Wirklichkeit „ist nicht vernünftig wegen ihrer eigenen Vernunft, sondern weil die empirische Thatsache in ihrer empirischen Existenz eine andre Bedeutung hat, als sich selbst“, da sie „nicht als solche, sondern als mystisches Resultat gefaßt“ wird.[13] Die Hegelsche Spekulation verkehrt das Verhältnis zwischen Subjekt und Prädikat: „Die Bedingung wird aber als das Bedingte, das Bestimmende wird als das Bestimmte, das Producirende wird als das Product seines Products gesetzt“. Die „wirklichen Subjekte“, Familie und bürgerliche Gesellschaft, werden in Prädikate der Idee verwandelt, während die Idee, das abstrakte Prädikat, „versubjektivirt“ wird. Wenn aber einerseits die Wirklichkeit, die „gewöhnliche Empirie“, „nicht als sie selbst, sondern als eine andere Wirklichkeit ausgesprochen“ wird, dann hat andererseits die versubjektivierte wirkliche Idee „nicht eine aus ihr selbst entwickelte Wirklichkeit, sondern die gewöhnliche Empirie zum Dasein“[14]. Die von Hegel durchgeführte Verkehrung ist keine der empirischen Wirklichkeit – das wäre dann so etwas wie ein Wunder –, sondern allein ihrer „Betrachtungsweise“ oder „Sprechweise“. Hegel gibt der Wirklichkeit eine bloß „scheinbare Vermittlung“, „die Bedeutung einer Bestimmung“, „eines Resultats, eines Produkts“ der Idee, aber er lässt den Inhalt, die Wirklichkeit selbst völlig unberührt.
Die Marxsche Kritik an Hegels Philosophie ist, wie bereits erwähnt, stark von Feuerbach beeinflusst worden. Dieser Einfluss wurde jedoch von den Kommentatoren oft falsch verstanden; Marx sollte lediglich die Positionen des Subjekts und des Prädikats mehr methodisch als urteilstheoretisch vertauscht und so Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt haben.[15] Marx privilegiert aber in Wahrheit nicht das methodologische Verfahren eines bloßen Austauschs von Subjekt und Prädikat, sondern er konzentriert sich vielmehr auf die Kritik der (onto-)logischen Voraussetzungen, die diesen Stellentausch provozieren. Er setzt also mit seiner Kritik eine Stufe tiefer an. Was Marx als das „Geheimnis“ der Hegelschen Spekulation denunziert ist, dass bei Hegel die Ontologisierung der Idee mit der Ent-Ontologisierung der empirischen Wirklichkeit Hand in Hand geht: Die Idee wird empirisch-real und die Realität wird zum logischen Setzungsakt eines imaginierten Geistes. Konkret gewendet: Die Idee des Staates ist der Schöpfer einer entsprechend vergeistigten Familie und bürgerlichen Gesellschaft. „Der konkrete Inhalt, die wirkliche Bestimmung, erscheint als formell; die ganz abstrakte Formbestimmung erscheint als der konkrete Inhalt“.[16] Der urteilstheoretischen Umkehrung des Subjekt-Prädikatsverhältnisses korrespondiert dann die ontologische Umkehrung zwischen den empirisch-realen und den idealen Bestimmtheiten, dem konkreten Inhalt und der abstrakten Idee oder, kurz, dem Sein und dem Denken. Die in ein wirkliches Subjekt verwandelte Idee hat dann konsequenterweise die Macht, aus sich selbst, einer creatio ex nihilo gleich, endliche Bestimmtheiten zu entlassen. Sie „erniedrigt sich nur in die ‚Endlichkeit’ der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft, um durch ihre Aufhebung ihre Unendlichkeit zu genießen und hervorzubringen“. Das endliche Sein ist nach dieser im übrigen an den Gottesbeweisen der Scholastik orientierten Auffassung nichts weiter als das objektive Moment der unendlichen Idee, das endliche Prädikat des unendlichen Subjekts. Marx kontrastiert diesem theistischen Konstrukt, und zwar unter dem Einfluss Feuerbachs, ein wissenschaftlich zu erforschendes bestimmtes, reales Sein. Seine Logik soll durch die Arbeit des Gedankens erarbeitet werden. In Feuerbachs Vorläufigen Thesen zur Reform der Philosophie liest sich das so: „Der Gedanke ist bei H[egel] das Sein; – der Gedanke das Subjekt, das Sein das Prädikat. (…) Das wahre Verhältnis vom Denken zum Sein ist nur dieses: Das Sein ist Subjekt, das Denken Prädikat.“[17]
Feuerbachs Kritik der Hegelschen Spekulation richtet sich also ebenfalls nicht gegen einen bloß methodologischen Fehler, sondern weist das Falsche innerhalb der ontologischen Bestimmung selbst nach, auf der die Methode beruht. Der Gott der Theologen ist folglich kein Geschöpf der wirklichen Menschen, sondern der Geschaffene wird, umgekehrt, zum Schöpfer stilisiert.[18] Das Abhängigkeitsverhältnis wird passenderweise nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch verkehrt. Die theoretische Akkommodation zeitigt unmittelbar, ganz im Sinne des Erfinders, praktische Folgen. Die logische Frage nach dem „Subjekt“ konzentriert sich dann auf die grundsätzliche ontologische Frage: „wer ist das Sein“, bzw. „das Wirkliche“. Die Antwort Feuerbachs auf dieses künstliche Dilemma lautet kurz und bündig: „Das Wirkliche in seiner Wirklichkeit oder als Wirkliches ist das Wirkliche als Objekt des Sinnes, ist das Sinnliche.“[19]
Auch Marx setzt sich, genau genommen, nicht nur mit Hegels Logik auseinander, sondern auch er konzentriert sich auf die dieser Gedankenwelt zugrundeliegenden realen Bestimmungen. Marx nimmt nicht vorrangig Anstoß an einer falschen Verwendung der Logik, und an einer Berichtigung derselben ist ihm allenfalls mitlaufend gelegen. Gerade weil sich bei Hegel die Logik letztlich gegen ihre realen Gründe verselbständigt hat, ist es nur konsequent, wenn sie, ein beliebig zu verwendendes Instrument des Gedankens, ein von den zu erkennenden Objekten getrenntes Eigenleben führt; sie weiß etwas, ohne sich auf die Gegenstände ihres Wissens eingelassen zu haben, eben weil es bloß diejenigen ihres Wissens sind. Freilich kann eine derartige formale Logik korrekt funktionieren, ja, sie muß es sogar, sofern man sich bei den jeweils vollzogenen Urteils- und Schlussformen regelkonform verhalten hat. Mit dem gedanklich zu erschließenden „spezifischen Wesen“ der empirischen Realität haben diese am Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs orientierten Formalismen allerdings überhaupt nichts zu tun. Eine Übereinstimmung zwischen den Formen des Gedankens und denen der Wirklichkeit ist hier purer Zufall und ein lediglich mögliches Resultat vorausgegangener Willkür. Ihr fehlt eben die Einsicht in die in der Sache begründete „Notwendigkeit“, weil sie nur, gemäß den Kriterien einer ausgewachsenen Vorurteilskunde, die Notwendigkeit des verselbständigten und anschließend objektivierten Gedankens reflektiert: „Hegel begnügt sich damit. Auf der einen Seite: Kategorie ‚Subsumtion’ des Besondern etc. Die muß verwirklicht werden. Nun nimmt er irgendeine der empirischen Existenzen des preußischen oder modernen Staats (wie sie ist mit Haut und Haar), welche unter anderm auch diese Kategorie verwirklicht, obgleich mit derselben nicht ihr spezifisches Wesen ausgedrückt ist. Die angewandte Mathematik ist auch Subsumtion etc. Hegel fragt nicht, ist dies die vernünftige, die adäquate Weise der Subsumtion? Er hält nur die eine Kategorie fest und begnügt sich damit, eine entsprechende Existenz für sie zu finden. Hegel gibt seiner Logik einen politischen Körper; er gibt nicht die Logik des politischen Körpers.“[20]
Was Hegel also fehlt, ist nicht eine wie auch immer brauchbare Logik nach dem Vorbild der Mathematik etwa, sondern die Einsicht in eine „vernünftige“, d.h. „adäquate Weise“ der „Subsumption“. Ihm ist ironischerweise beim Denken das Kriterium jeder logischen Kategorie abhanden gekommen: nichts weiter als ein Vehikel des theoretischen Einblicks in die wie auch immer geartete ontologische „Notwendigkeit“ zu sein. Folglich produziert sein sich selbst denkendes Denken immer bloß Denksetzungen oder kurz: Tautologien. Marx hingegen interessiert sich für gewisse Bereiche der von ihrer spekulativen Reduzierung auf ein bloßes Erscheinen der logischen Idee befreiten empirischen Realität, also in der Folgezeit beispielsweise für die Verwertungsformen des Kapitals.
In dieser, wenn man so will, neuerlichen kopernikanischen Revolution wird das Gravitationszentrum der Logik neu bestimmt. Der Gedanke der Sache hat einer der Sache und ihrer Bestimmungen zu sein.
IV
Der zweite Aspekt der Marxschen Kritik kreist um das Thema der politischen Entfremdung. Der politische Staat und seine Verfassung ist laut Marx der verselbständigte „Gattungswille“ des tatsächlichen Souveräns. Das Volk ist der „wirkliche Staat“, die Grundlage der Verfassung, weil es die konstituierende Gewalt ist; die Verfassung ist entsprechend nichts weiter als die konstituierte Gewalt. Die politische Entfremdung besteht folglich darin, dass sich das Volk seinem eigenen Werk unterwirft, bzw. ihm durch das Macht- und Gewaltmonopol des Staates unterworfen wird. Was das „Ganze“ war, wird jetzt zum bloßen funktionalen Anhängsel, und vice versa. Das Volk, das vorher der „wirkliche Staat“ war, wird seines Gattungsinhalts beraubt, der nunmehr auf der politischen Ebene hypostasiert wird. Das Ergebnis ist der Gegensatz des Staates und seiner Verfassung von der bürgerlichen Gesellschaft oder von politischem und unpolitischem Staat.
Dieser für den modernen Staat typische Gegensatz ist hinter dem Hegelschen Schleier der Spekulation nicht mehr wahrnehmbar. Der Staat ist für ihn die Verwirklichung des freien, vernünftigen Willens. In den Grundlinien der Philosophie des Rechts verwirklicht sich der Staat dadurch, daß er die abstrakten Stufen der Familie und bürgerlichen Gesellschaft aufhebt und seine Einheit als konkrete Allgemeinheit realisiert. Der Staat ist der selbstbewusst gewordene freie Wille: „der freie Wille, der den freien Willen will“,[21] und der vernünftige Zweck des Menschen ist das restlose Aufgehen im Staat. In den drei Gewalten der Verfassung ist die Idee des Staates als eine Einheit von Gegensätzen begriffsadäquat verwirklicht.
Nach Marx jedoch ist die Verfassung „nichts als eine Akkommodation zwischen dem politischen und unpolitischen Staat”, ein „Traktat wesentlich heterogener Gewalten“. Sie ist ein Gegensatz von “wirklichen Extremen”, ein “mixtum compositum”.[22] Dieser Dualismus liegt Hegels Konstrukt der konstitutionellen Monarchie zugrunde: Die in der Person des Monarchen Gestalt gewordene fürstliche Gewalt, die der personifizierte Staat ist, abstrahiert von der Pluralität der „Personen“ – den vielen „Einzelheiten“, die das Volk bilden – (§§ 275-286). Die für die Regierungsgewalt tätige Bürokratie der Privilegierten bildet eine Korporation gegen die bürgerliche Gesellschaft (§§ 287-297). In der gesetzgebenden Gewalt schließlich tritt der Gegensatz zwischen der empirischen Einzelheit des Fürsten und der empirischen Allgemeinheit der bürgerlichen Gesellschaft offen hervor. Er setzt sich fort in der Differenz zwischen der Regierung und den Ständen, um schließlich in der leicht absurden Form der von den Majoratsherren gebildeten zweiten Kammer in Erscheinung zu treten (vgl. die §§ 298-313).
Die Verfassung ist laut Hegel, der hierin Montesquieu folgt, nicht etwa ein Kodex positiver Gesetze, sondern das Produkt des Volksgeistes, in den sich die hauptsächlichen Bestimmungen des vernünftigen Willens zusammenfassen. Um konsequent zu sein, sollte eine solche Auffassung Marx zufolge den Menschen zum „Prinzip der Verfassung“ machen, die „in sich selbst die Bestimmung und das Prinzip hat, mit dem Bewußtsein fortzuschreiten“.[23] Als etwas Besonderes muss die Verfassung ein „Teil des Ganzen“, also ein Moment des „Gattungswillens“ sein. Insofern er das wahrhaft Allgemeine ist, muss er auch das Ganze sein. In der Hegelschen Spekulation jedoch werden diese zwei Bedeutungen durcheinandergebracht: obgleich Hegel die Verfassung als etwas Allgemeines zu behandeln vorgibt, entwickelt er sie vielmehr als etwas Besonderes. Genau deswegen hat das in einen subordinierten Teil der Verfassung verwandelte Volk kein Recht, „die Verfassung selbst, das Ganze, zu modifizieren“.[24] Das entpolitisierte Volk ist, bar seines Gattungswesens, zu einer atomistischen Menge, einer gestaltlosen Masse pervertiert worden, die vom verselbständigten Staat eine seinem jeweiligen Kalkül gemäße politische Form verpaßt bekommt. Das Volk tritt entsprechend nicht als es selbst, als der „ganze Demos“ auf, sondern als die auf das ständische Moment reduzierte bürgerliche Gesellschaft. Das ist nach Marx die erste „ungelöste Kollision“ innerhalb des Verfassungsbegriffs: Die Kollision „zwischen der ganzen Verfassung und der gesetzgebenden Gewalt“[25].
Die zweite Kollision, als direkte Folge der ersten, ist „die zwischen der gesetzgebenden und der Regierungsgewalt, zwischen dem Gesetz und der Exekution“. Durch sie verliert die gesetzgebende Gewalt ihre unterstellte Allgemeinheit und wird ein bloßer „Teil“ des Ganzen, eine besondere Gewalt neben anderen Gewalten: es ist „also dem Gesetz unmöglich, auszusprechen, daß eine dieser Gewalten, ein Teil der Verfassung, das Recht haben solle, die Verfassung selbst, das Ganze, zu modifizieren“.[26] Der Konflikt zwischen dem Volk und dem politischen Staat stellt sich auf diese Weise als der Konflikt des „Volkes en miniature“ – der gesetzgebenden Gewalt – mit der Regierungsgewalt dar.
Die Marxsche Kritik an der politischen Entfremdung ist zu diesem Zeitpunkt im übrigen unauflöslich mit dem Denken Rousseaus verknüpft. Beide bemängeln, dass die Regierungsgewalt nicht mehr ein dem allgemeinen Willen unterworfener „Teil“ sei. Sie tritt diesem Willen als selbständige Gewalt entgegen, so dass der allgemeine Wille umgekehrt nichts weiter ist als die abhängige Variable der besonderen Gewalt des Staates. Mit der theoretischen Lösung dieses Problems ringt auch der Aufklärer Rousseau. Marx gibt ihm allerdings eine praktische Wendung: „Wird die Frage richtig gestellt, so heißt sie nur: Hat das Volk das Recht, sich eine neue Verfassung zu geben? Was unbedingt bejaht werden muß, indem die Verfassung, sobald sie aufgehört hat, wirklicher Ausdruck des Volkswillens zu sein, eine praktische Illusion geworden ist.“[27]
Folglich macht sich Marx in ZKhR für die Entwicklung einer Idee von Demokratie stark, die im Widerspruch steht zur Hegelschen Verteidigung der lediglich abgemilderten Souveränität des Monarchen. In der Monarchie, sowie in allen von der Demokratie abweichenden Staatsformen „hat dies Besondre, die politische Verfassung, die Bedeutung des alles Besondere beherrschenden und bestimmenden Allgemeinen“[28] In der Demokratie hingegen „ist die Verfassung, das Gesetz, der Staat selbst nur eine Selbstbestimmung des Volks und ein bestimmter Inhalt desselben, soweit er politische Verfassung ist“.[29] In der Demokratie ist die Macht des allgemeinen Willens nicht von derjenigen des politischen Staates entfremdet. Er verwandelt sich in ihr nicht in einen besonderen, vom Staat getrennten Inhalt: „In der Demokratie ist der Staat als Besondres nur Besondres, als Allgemeines das wirkliche Allgemeine, d.h. keine Bestimmtheit im Unterschied zu dem andern Inhalt“.[30] Die Demokratie ist daher die „Wahrheit“, die „Gattung“, „das aufgelöste Rätsel aller Verfassungen“.
Es ist allerdings zu beachten, dass in Marx‘ Gedankengang zwei Aspekte der „Demokratie“ unterschieden werden müssen: sie ist zum einen, als „Gattung“, die „wahre Demokratie“ und als „Spezies“ die „politische Republik“. Die „wahre Demokratie“ ist ein politisches Prinzip und nicht etwa ein real existierender Staat. Sie bedeutet die vollständige Verwirklichung des Staates als konkrete Allgemeinheit, die wahre Aufhebung des Gegensatzes zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft. In der wahren Demokratie „geht der politische Staat” genauso „unter“ wie der unpolitische Staat, d.h. die bürgerliche Gesellschaft.[31] Mit dem Begriff „politische Republik“ dagegen charakterisiert Marx die Demokratie innerhalb des „abstrakten Staats“, also die bestehende, noch nicht völlig verwirklichte Demokratie. In diesem Staat, obwohl hier die Verfassung letztlich noch eine politische ist, hört sie doch auf, „nur politische Verfassung zu sein“, und das bedeutet, dass die unpolitischen Ebenen schon von dem politischen „Gattungsinhalt“ durchdrungen sind.
Innerhalb des abstrakten Staates tritt die Frage der politischen Entfremdung in der Form des Gegensatzes zwischen repräsentativer und ständischer Verfassung in Erscheinung. Gegen die bloße Repräsentation der Stände verteidigt Marx „die Ausdehnung und möglichste Verallgemeinerung der Wahl, sowohl des aktiven, als des passiven Wahlrechts“.[32] Hier trifft sich das Marxsche Denken wieder mit demjenigen Rousseaus. Der von der Besonderheit der Interessen geprägt Wille aller (volonté de tous) verwandelt sich in den allgemeinen Willen (volonté générale) vermittelst der „Differenzsumme“ dieser Interessen. Das Volk „will stets sein Bestes, sieht jedoch nicht immer ein, worin es besteht“.[33] Ein Quidproquo stellt sich in dem Augenblick ein, wenn sich Gesellschaften (Parteien, Vereinigungen) innerhalb des Volkes zu konsolidieren beginnen: „so wird der Wille jeder dieser Gesellschaften in Beziehung auf ihre Mitglieder ein allgemeiner und dem Staate gegenüber ein einzelner“ und „die Differenzen werden weniger zahlreich und führen zu einem weniger allgemeinen Ergebnis“. Am Ende dieses Prozesses „gibt es keinen allgemeinen Willen mehr, und die Ansicht, die den Sieg davonträgt, ist trotzdem nur eine Privatansicht“. Gegen diese Fehlentwicklung gibt es, laut Rousseau, nur das eine Mittel, dass „es im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur für seine eigene Überzeugung eintreten soll“.[34]
Bei Marx sollten entsprechend die Einzelnen nicht unter die politisch-ständische Form der gesetzgebenden Gewalt subsumiert werden, sondern als Einzelne (als der „ganze Demos“) an dem jeweiligen Staat vermittelst der nach Möglichkeit allgemeinen Wahl teilnehmen. Damit werde die „bürgerliche Gesellschaft sich erst wirklich zu der Abstraktion von sich selbst, zu dem politischen Dasein als ihrem wahren allgemeinen wesentlichen Dasein erhoben“, also – mit Rousseau gesprochen – nicht mehr zu einem Konglomerat gegensätzlicher Privatinteressen, sondern zu einer „Differenzsumme“, die zur Bildung des allgemeinen Willens führe. Die Vollendung dieses Prozesses der Verallgemeinerung der bürgerlichen Gesellschaft sei die „Aufhebung“ der Abstraktion selbst: „Indem die bürgerliche Gesellschaft ihr politisches Dasein wirklich als ihr wahres gesetzt hat, hat sie zugleich ihr bürgerliches Dasein, in seinem Unterschied von ihrem politischen, als unwesentlich gesetzt; und mit dem einen Getrennten fällt sein Andres, sein Gegenteil. Die Wahlreform ist also innerhalb des abstrakten politischen Staats die Forderung seiner Auflösung, aber ebenso der Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft.“[35]
Hegels Verteidigung der ständischen Verfassung hingegen beruht auf der Auffassung des Volkes als „einer formlosen Masse, deren Bewegung und Tun eben damit nur elementarisch, vernunftlos, wild und fürchterlich“ ist. Volk und Staat sind bei Hegel die zwei Extreme eines Syllogismus‘, dessen Vermittlung durch die Stände geschieht. Laut Marx sind die Stände jedoch keine Auflösung, sondern vielmehr die Verwirklichung des Gegensatzes innerhalb des politischen Staates.
Bei Gelegenheit der Kommentierung der §§ 302-304 denunziert Marx die Unzulänglichkeiten des Hegelschen Systems der Vermittlungen.[36] Erstens begeht Hegel Marx zufolge einen Paralogismus, da er die Bedeutung der Stände innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft mit jener Bedeutung identifiziert, die die Stände auf der politischen Ebene haben. Hegel begreift als reflexives Verhältnis, was laut Marx ein bloßes Abstraktionsverhältnis ist. Die politischen Stände sind für Marx kein Reflex der privaten Stände, also eines vermeintlich Anderen, sondern sie sind nichts weiter als die Abstraktion dieser Stände: Die bürgerliche Gesellschaft wird als „nicht vorhanden”[37] gesetzt. Das politisch-ständische Element bedeutet daher nicht die Aufhebung der Unterschiede innerhalb der gesellschaftlichen Stände – eine wirkliche Vermittlung des Widerspruchs –, sondern das Zudecken dieser nach wie vor bestehenden Unterschiede vermittelst ihrer Eingliederung in eine anachronistische mittelalterliche, politische Form.
Zweitens kaschiere das Hegelsche System der Vermittlungen eine tatsächliche, unversöhnliche Opposition zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft. Sie sind, Marx zufolge, wirkliche Extreme, die „nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind“. Zwischen ihnen kann es kein reflexives Verhältnis geben, da sie „nichts miteinander gemein“ haben; „sie verlangen einander nicht, sie ergänzen einander nicht“.[38] Unter dem Einfluss Feuerbachs stellt Marx hier zwar dem Begriff „Reflexion“ einen anderen Begriff der Hegelschen Logik gegenüber: den Begriff der „Selbstbestimmung des Subjekts“.[39] Als wirklicher Staat muss die bürgerliche Gesellschaft die Selbst- bzw. Gattungsbestimmung in sich selbst verwirklichen, weil ansonsten der Staat zu einer „allegorischen, untergeschobenen Bestimmung” wird. Durch die demokratisierte gesetzgebende Macht ist die politische Qualität des Menschen – jeder Einzelne als Moment des Gattungswesens – nicht mehr ein von seiner gesellschaftlichen Qualität getrenntes Wesen. Umgekehrt formuliert: Die gesellschaftliche Qualität des Menschen beweist in der demokratischen Repräsentation ihre politische Eigenart, ihr Gattungswesen. Im Unterschied zu anderen Staatsformen schafft die wahre Demokratie kein politisches Fundament für eine rein private Existenz des Menschen, sondern gibt ihm sein eigenes politisches Wesen bzw. sein „Gattungsdasein“ zurück. Denkt man Rousseau und Feuerbach zusammen, dann kommt es zu einer Synthese der politischen mit der Gattungsrepräsentation. Jeder Mensch repräsentiert den jeweils anderen, weil „jede bestimmte soziale Tätigkeit als Gattungstätigkeit nur die Gattung, d.h. eine Bestimmung meines eignen Wesens repräsentiert“. Er ist Repräsentant nicht mehr im Sinne der dualistischen, politisch-abstrakten Repräsentation, oder kurz, er ist „nicht durch ein anderes, was er vorstellt, sondern durch das, was er ist und tut“.[40]
__________________________________________
- Der vorliegende Text ist die überarbeitete deutsche Version der „Einleitung“ der brasilianischen Ausgabe von Marx’ Zur Kritik des hegelschen Rechtsphilosophie, die vom Autor übersetzt wurde. Herr Dr. Frank-Peter Hansen war mir dankenswerter Weise bei der Übertragung ins Deutsche behilflich.↵
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse
, Berlin 1820.↵
- Karl Marx, Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, MEGA
², I/1, 1975, S. 67.↵
- Karl Marx, Das philosophische Manifest der historischen Rechtsschule, MEGA², I/1, 1975, S. 191-193. Vgl. auch Rubens Enderle, „O jovem Marx e o manifesto filosófico da Escola Histórica do Direito”, in: Crítica Marxista, n. 20, São Paulo 2005.↵
- Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEGA², I/1, S. 100-101.↵
- Karl Marx, Ein Briefwechsel von 1843, MEGA², I/2, S. 488.↵
- Karl Marx, Karl Marx an Arnold Ruge, 5. März 1842, MEGA², III/1, S. 22.↵
- Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, MEGA², II/2, S. 99-100.↵
- Karl Marx, Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz, MEGA². I/1, 1975, S. 209.↵
- Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, a.a.O., S. 100.↵
- Die Deutsch-Französischen Jahrbücher wurden erstmals im Februar 1804 in Paris veröffentlicht.↵
- Von dem originalen Text, der angeblich mit dem § 257 des Hegelschen Werkes anfing, sind die vier ersten Seiten verschollen. Deswegen fängt das uns heute bekannte Manuskript der ZKHS mit der Wiedergabe und dem Kommentar des § 261 an und dehnt sich bis auf den § 313 aus, übrigens viele §§ vor dem Ende des Dritten Abschnitts (§ 360). Außerdem fehlen der Pappdeckel und das vordere Deckblatt, was zu Spekulationen darüber führte, welchen Titel Marx diesem Werk geben wollte. Bei seiner ersten Veröffentlichung durch Rjazanov (MEGA¹) 1927 erschien der Text unter dem Titel „Karl Marx: Aus der Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ 261-313)“. Seit der 1982 erschienenen Ausgabe der MEGA² wird er „Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie“ genannt. Dies ist laut dem Verleger der wahrscheinlichste Titel des Werkes, da Marx einige Monate später in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern den Text „Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ veröffentlichte. Vgl. MEGA², I/2, S. 584.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 9.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 8.↵
- Ein gutes Beispiel für diese metodologisch orientierte Interpretation ist Schlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, S. 10-17. Vgl. auch Miguel Abensour, La Démocratie cont re l’État. Marx et le moment machiavélien, Collège International de Philosophie Janvier 1997, P.U.F, S. 50 ff.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O, S. 16.↵
- Ludwig Feuerbach, „Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie“. Ludwig Feuerbach – Gesammelte Werke: Kleinere Schriften II. 1839-1846. (Bd. 9)
, Akademie Verlag, Bd. 9, Berlin 1970, S. 257.↵
- „Die spekulative Philosophie hat sich desselben Fehlers schuldig gemacht als die Theologie – die Bestimmungen der Wirklichkeit oder Endlichkeit nur durch die Negation der Bestimmtheit, in welcher sie sind, was sie sind, zu Bestimmungen, Prädikaten des Unendlichen gemacht.“ Ludwig Feuerbach, „Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie“, a.a.O., S. 250-251.↵
- Ludwig Feuerbach, „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“, a.a.O.., S. 316.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 52.↵
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, a.a.O., § 27.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 61.↵
- A. o. O., S. 20.↵
- A. o. O., S. 61.↵
- Ebd.↵
- Ebd.↵
- Ebd.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 32.↵
- Ebd.↵
- Ebd.↵
- Ebd.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 130-131.↵
- Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag
, übers. von Hermann Denhardt, Frankfurt am Main 2005, S. 64.↵
- Jean-Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag, a.a.O., S. 64-65.↵
- Karl Marx, ZKhr, a.a.O., S. 131.↵
- Zu einer detaillierten Analyse der Marxschen Kritik des Hegelschen Systems der Vermittlungen, vgl. Solange Mercier-Josa, Entre Hegel et Marx, Paris, L’Harmattan, 1999, S. 27-73.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 87.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O., S. 98.↵
- Vgl. dazu Solange Mercier-Josa, a.a.O., S. 38.↵
- Karl Marx, ZKhR, a.a.O.↵