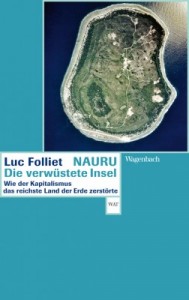von Hans W. Giessen
von Hans W. Giessen
- FLYNN, Michael F.: Eifelheim. Tor, New York 2006. Reprint 2009. ISBN
978-0765340351.
Das Buch „Eifelheim“ hat einen deutsch klingenden Titel, obgleich es ein amerikanisches Buch ist, von einem amerikanischen Autor, in einem amerikanischen Verlag erschienen. Aber der Titel trügt nicht: „Eifelheim“ ist der Name eines „deutschen“ Dorfes, genauer: eines Schwarzwalddorfes zur Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit (also, wenn wir streng sind, zu einer Zeit, als es „Deutschland“ noch nicht gab).
Tatsächlich handelt es sich um zwei Parallelgeschichten, die sich einerseits im titelgebenden Ort „Eifelheim“ des 14. Jahrhunderts und zum anderen in der (in einer nahen Zukunft angesiedelten) Gegenwart eines Akademikerpärchens an einer US-amerikanischen Universität entwickeln. Verbunden werden die beiden Geschichten in der Person des Historikers Tom Schwoerin. Er versucht, herauszufinden, wieso der Ort im Jahr 1349 nach einer Pestepidemie aufgegeben und dann nie wieder besiedelt wurde, obgleich es sich von der Lage her angeboten hätte. Alle geographischen und ökonomischen Daten sprechen dafür, dass hier eine Siedlung stehen müsste. Es muss also etwas Dramatisches passiert sein, dass es dazu nicht gekommen ist – aber was? Dies erläutert der Teil der Handlung, der in „Eifelheim“ selbst angesiedelt ist. Wobei die Handlung selbst schnell erzählt ist – es handelt sich gerade nicht um eine mäandernde, aber vorwärtstreibende ,Handlung’ im Sinn anderer historischer Romane à la „Wanderhure“, die auf eine anderes Publikum zielen, das Sex und Krimieffekte im historischen Ambiente sucht. „Eifelheim“ beschreibt Sozialstrukturen, Verhaltensschemata, philosophische und weltanschauliche Konzepte, dazu kommen wissenschaftliche Konzepte insbesondere aus der Quantenphysik – aber weniger vorwärtstreibende Handlung im Sinn zahlreicher äußerer Ereignisse. Von daher können die Ereignisse des Buches hier bedenkenlos erzählt werden, da die Spannung andere Quellen hat. Immerhin beginnt die Geschichte buchstäblich mit einem Donnerschlag: Ein Raumschiff stürzt in einen nahegelegenen Wald. Offenbar handelt es sich um eine Bruchlandung, die Passagiere sind auf der Erde gestrandet, müssen ihr Raumschiff reparieren. Der Dorfpfarrer entdeckt eine Art Haus, das plötzlich im Wald aufgetaucht ist. In der Folge liegt der Schwerpunkt dann aber nicht mehr auf schnellen Handlungseffekten. Vielmehr geht es um den sich langsam anbahnenden Kontakten zwischen den Außerirdischen, insektenartig aussehenden Wesen, die von den Menschen, die ihre Sprache und Art des Kommunizierens nicht verstehen, „Krenken“ genannt werden.
Das Buch wirbt, meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt, mit einem Zitat aus einer Rezension des “Entertainment Weekly“: “Carl Sagan meets Umberto Eco“. Wobei der Hinweis auf den Astrophysiker Sagan eher auf seinen Roman “Contact“ aus dem Jahr 1995 abzielt als auf seine wissenschaftlichen Bücher (von denen in Deutschland sicherlich und zumindest noch “Cosmos“ aus dem Jahr 1980 bekannt sein dürfte), und der Hinweis auf Eco ebenfalls nicht vorrangig den Semiotiker meint, sondern wohl eine Referenz auf seinen berühmtesten Roman „Il nome della rosa“, ebenfalls aus dem Jahr 1980, darstellt, der in der selben Zeit wie „Eifelheim“ spielt (korrekterweise: zwanzig Jahre früher, 1327). Also ein Buch, das literarische Kategorien überschreitet, natürlich historischer Roman, gleichzeitig Science-Fiction, ebenso aber auch philosophischer Dialog…
Die Außerirdischen sind im Wortsinn Fremde, im Denken, Handeln, im Anblick. Sie sind auf den ersten Blick ausgesprochen unsympathisch: nicht nur, dass sie bizarr aussehen, wie übergroße, graufarbene Heuschrecken. Sie sind auch cholerisch, neigen zu Gewaltausbrüchen, sind eingebunden in eine strenge Hierarchie, dort äußerst statusorientiert. Insektenmäßig ist also nicht nur ihr Aussehen: Ihre Instinkte sind durch ihre Jugend geprägt, die sie in einem bienenartigen Schwarm erleben. Aber die Krenken werden, ihrer Sozialstruktur zum Trotz, dennoch auch als Individuen gezeichnet. Manche werden geradezu sympathisch, andere bleiben unangenehm. In der Tat ist ein Reiz des Buches, dass und wie sehr es sie sich als individuelle, realistisch anmutende ,Personen’ entwickeln lässt.
Was ich besonders faszinierend finde, ist, dass es eher die Außerirdischen sind, die sich den Menschen zuwenden, als umgekehrt. Unter den Dorfbewohner gibt es nur wenige, die neugierig sind, wieso die Krenken hierhergekommen sind, wie es in der Hölle (oder wo auch immer diese Wesen herstammen) aussieht, geschweige denn, wer sie wirklich sind. Offensichtlich ist die Gegenwart, sind die eigenen Ängste zu dominant – oder ist die menschliche Natur so? Aber auch hier zeichnet Michael F. Flynn ein differenziertes Bild. Einige Dorfbewohner suchen den Kontakt. Zunächst fühlt sich der Dorfpfarrer durch ihre Ankunft herausgefordert und versucht, herauszufinden, was dies für das Dorf bedeutet.
Pfarrer Dietrich ist eine faszinierende Figur. Er hat in Paris bei den berühmtesten Gelehrten seiner Zeit studiert, bei Jean Buridan, seinerseits Schüler Wilhelm von Ockhams (der im Buch auch einen Gastauftritt hat). Offenbar hatte er dann aus theologischen ebenso wie sozialen Gründen einen Bauernaufstand unterstützt – er hat also konkrete Schlüsse aus Ockhams Philosophie gezogen. Natürlich hat er sich dabei mächtige Gegner gemacht; sein Leben scheint bedroht gewesen zu sein. So wird erklärt, warum dieser gebildete und hochintelligente Mann fast versteckt in einem abgelegenen Schwarzwalddorf lebt. Dietrich hat also seine Wunden. Emotional ist er deshalb vorsichtig, lässt sich nicht direkt auf seine Mitmenschen ein, wirkt eher ,verkopft’ – auch er ist eine zwiespältige Figur, nur begrenzt sympathisch. Aber er ist nicht tumb und lehnt Fremdes einfach deshalb ab, weil es fremd und anders ist. Dennoch bleibt er in seiner Zeit verwurzelt. Flynn beschreibt keinen ,Gegenwartmenschen’, der halt in einer anderen Epoche lebt. Nein, Dietrich ist durchdrungen von der Theologie seiner Zeit. Und er hat große Schwierigkeiten, die Krenken, ihre Technologie und Sozialstruktur zu verstehen, beziehungsweise in Begriffe und Konzepte zu übersetzen, mit denen er umgehen kann. Aber die Ockhamsche Theologie (oder seine Persönlichkeit) veranlassen ihn doch, auf die Krenken zuzugehen und ihnen zu helfen. Die Kommunikation erfolgt über einen Übersetzungscomputer, den die Außerirdischen besitzen. Dennoch bleibt sie schwierig. Da das Vokabular bei Krenken und Menschen semantisch höchst unterschiedlich besetzt ist, entstehen faszinierende Diskussionen. Um zu erklären, wie Weltraumflüge funktionieren, erklären die Krenken quantenphysikalische Phänomene. Dietrich kann dies natürlich nicht verstehen – aber: er versteht dennoch, denn er fügt die Informationen der Außerirdischen in sein theologisches Konzept ein. So gehen die Diskussionen (die wir Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts aus beiden Perspektiven zumindest abstrakt nachvollziehen können) oft haarscharf aneinander vorbei – und ergeben doch auf merkwürdige, äußerst faszinierende Art einen neuen ,Sinn’. Und es funktioniert auch umgekehrt: Theologische Aussagen Dietrichs werden von den Krenken als Anmerkungen zu (oder Umschreibungen von) quantenphysikalischen oder astronomischen, aber auch sozialen Prozessen interpretiert. Wenn beispielsweise Jesus der bald zurückerwartete – es herrscht ja Endzeitstimmung – “Lord of the stars“ ist: Bedeutet dies, dass er ein Raumfahrer ist, der die Krenken aufgrund seiner Erfahrungen und seines Wissens aus ihrer Situation erlösen kann?
Auch das hat mir gut gefallen: Der Konflikt zwischen figurativer und konkreter Sprache ist ein wichtiges Subthema des Buches. Die Außerirdischen haben keine ,Antenne’ für Metaphern – die aber die christliche Theologie dominieren. Dies erweist sich als noch einschneidender als die unterschiedlichen Kenntnisse über die Naturgesetze, über die Welt, über Welterklärungskonzepte. Sprachliche Kommunikation und die dadurch entstehenden Missverständnisse und dann doch wieder aufflackernden Momente des Einvernehmens sind auf jeden Fall der entscheidende Knackpunkt im Verhältnis zwischen Dietrich und den Außerirdischen. Allein die Art, wie Flynn den Umgang, die Kommunikation zwischen Menschen und Krenken konzipiert hat, ist faszinierend, die theologischen Diskurse des Buchs sind mitunter atemberaubend.
Die Gegensätze zwischen Krenken und spätmittelalterlichen Dorfbewohnern sind im Übrigen fast genauso groß wie zwischen dem Pfarrer und Teilen seiner Gemeinde. Dietrich wird von Bruder Joachim von Herbolzheim unterstützt, der Franziskaner ist. Joachim kann mit der eher vernunftbetonten Theologie Dietrichs nichts anfangen: Seine Religiosität ist ausschließlich emotional begründet. Er sieht in den Krenken sofort Dämonen. Dies meint auch die Mehrheit der Dorfbewohner. Man kann es ihr nicht verübeln, der Augenschein scheint ihnen Recht zu geben: Die Fremden können fliegen, auch wenn sie keine Flügel haben. Und so entwickelt sich als erste Frage, was denn die eigentliche Herausforderung sei: Muss man die Fremden eliminieren oder bekehren? Pfarrer Dietrich will die Krenken bekehren. Dazu muss zunächst die theologische Frage geklärt werden, ob Außerirdische überhaupt Christen sind oder werden können. Schließlich gelingt es ihm, sich mit einigen der Krenken anzufreunden und sie zu überzeugen. Dem ersten Täufling gibt er den Namen Hans. Damit ist auch – und zumindest – bewiesen: Die Krenken haben eine Seele. Und: Die christliche Botschaft ist so stark, dass ihr Einfluss sogar die ursprüngliche Natur der Krenken überwindet.
Die Außerirdischen haben weitere Integrationserfolge. Bemerkenswerterweise gibt es sogar Parallelen zwischen der hierarchischen Gesellschaftsstruktur der Krenken und der spätmittelalterlichen Feudalordnung. Auch dies erlaubt es den Krenken, sich anzupassen, und der lokale Potentat Manfred von Hochwald kann gar, überraschend problemlos, ein Lehnsverhältnis der Krenken akzeptieren. Er ernennt einen der Außerirdischen, der ihm behilflich ist, gar zum Baron Großwald.
Beeindruckend ist also, wie Flynn die Konsequenzen des Kontakts zwischen Menschen und Krenken gestaltet. Die Menschen ändern sich letztlich kaum, ihre Persönlichkeitsstrukturen bleibt gleich – auch die des in der Geschichte so dominanten Pfarrers Dietrich, der zwar offen und (scheinbar) tolerant auf die Fremden zugeht, aber doch so sehr in seinem Weltbild verhaftet ist, dass er sie zu bekehren versucht und ihn die Vorstellung umgekehrter Anpassung an die Kultur der technologisch weiterentwickelten Wesen undenkbar erscheint. Dagegen erwägen und akzeptieren einige der Krenken in der Tat menschliche Normen und Werte. Sie machen emotional wie intellektuell den größeren ,menschlicheren’ Schritt. Die christliche Bekehrung und Taufe sind dafür nur die (aus menschlicher Sicht) extremsten Gesten. Schließlich wird das Dorf von der Pest erreicht. Der Dorfpfarrer versucht sein Möglichstes, den sterbenden Dorfbewohnern zu helfen. Die Krenken haben ihr Raumschiff repariert und wollen die Erde wieder verlassen. Aber einige bleiben, um der Dorfbevölkerung zu helfen und die Toten zu begraben. Sie sind humaner geworden als die meisten Menschen des Dorfes, sie orientieren sich am Dorfpriester – während sich, natürlich, kein Mensch an ihnen orientiert.
Dies ist besonders faszinierend: Flynn kann glaubhaft darstellen, dass und warum verschiedene Außerirdische, obgleich einer überlegenen Technologie entstammend, lieber in einem pestverseuchten spätmittelalterlichen Schwarzwalddorf bleiben wollen, um dort als Christen (im spätmittelalterlichen Sinn des Wortes) weiterzuleben. Bald sterben aber auch sie. Manche kommen in Kämpfen um, manche erfrieren, aber vor allem leiden sie an der irdischen Nahrung, der eine Aminosäure fehlt, die sie zum Überleben benötigen. Sie besitzen zwar technologische Möglichkeiten, die den menschlichen Erfahrungshorizont übersteigen. Aber ihre Lage ist dennoch so verzweifelt wie die der Dorfbewohner. So diskutieren der Pfarrer und sein außerirdischer Freund Hans philosophische Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Ursache von Unheil.
Rund 700 Jahre später ist die Stelle, an der das Dorf existiert hatte, noch immer verwaist. Im ,Gegenwartsteil’ des Buches stößt Tom Schwoerin, der Historiker, der mathematisch-statistische Methoden nutzt, um zu neuen Erkenntnissen über historische Probleme zu gelangen, auf die erstaunliche Tatsache dieser Wüstung. Auch der ,Gegenwartsteil’ ist spannend und faszinierend. Die ,Handlung’ ist Folge des Zusammenlebens des Historikers mit einer theoretischen Physikerin, Sharon Nagy. Beide sind in einer schwierigen Phase ihrer Beziehung, in ihre Arbeit vertieft, vom jeweils anderen genervt. In solchen Situationen bringen sie oft abfällige Bemerkungen des anderen weiter. Einmal schleudert Tom beiläufig Sharon den Vorwurf entgegen, dass die Lichtgeschwindigkeit, Einstein zum Trotz, auch unter identischen Bedingungen nicht gleich sei. Wütend überprüft Sharon den Vorwurf – und muss in der Tat feststellen, dass die Lichtgeschwindigkeit seit Messbeginn (wenngleich nur minimal) langsamer geworden ist. Zunächst vermutet sie, dass einfach die Messmethoden präziser geworden sind. Aber dann bestätigt sich der Vorwurf ihres Lebensgefährten.
Sie erforscht die Rätsel von Raum und Zeit und entwirft ein zwölfdimensionales Universum – und entdeckt dabei exakt die Mechanismen, die die Außerirdischen für ihre Reise genutzt haben. Zunächst aber muss ihr Partner das Rätsel des Dorfes lösen. Infolge mühsamer Recherchen erfährt er, das ,Eifelheim’ zunächst ,Oberhochwald’ hieß und erst nach den Ereignissen von 1348 und 1349, nachdem der Ort also aufgegeben war, als ,Teufelheim’ bezeichnet wurde; daraus entwickelte sich dann ,Eifelheim’. Eine beiläufige Nebengeschichte schildert die Hilfe, die Schwoerin von einer Bibliothekarin erhält, die ihn offenbar als Forscher (und darüber hinaus) anhimmelt. Aber er ist so absorbiert, dass er darauf nicht eingeht. So bleibt er bei Sharon – zum Glück (nicht nur für seine Beziehung), denn die eigentliche Lösung des Rätsels ist Sharon zu verdanken. Beide reisen schließlich nach Freiburg und von dort weiter zur Wüstung Eifelheim, und finden sogar das (christliche) Grab des Krenken Hans – und dort eine Art Plan, der die Theorie von Sharon bestätigt und erklärt, wie die Außerirdischen durchs Weltall reisen konnten. Mithin haben die Forschungsfragen ihres Freundes auch die theoretische Physikerin weitergebracht, ihr sogar zu einem empirischen Beweis ihrer theoretischen Überlegungen verholfen. Michael Flynns Roman ist so präzise durchkomponiert, dass Vergangenheit und Zukunft sowie Geschichte (Geistes- beziehungsweise Sozialwissenschaft) und Physik (Naturwissenschaft) jeweils exakt den Schlüssel zur Erklärung und Lösung der gegenseitigen Fragestellungen und Probleme bieten. Die Ökonomie des Romans hat zur Folge, dass die jeweiligen Epochen, Ergebnisse, Geschichten und Welterklärungen, so verschieden sie objektiv sind, zueinander passen wie Puzzleteile.
Die Zeit, das Dorf, die Menschen – alles ist sehr glaubwürdig, gerade weil nichts einseitig (perfekt, gut – oder schlecht) ist. Michael F. Flynn geht fair mit dem spätmittelalterlichen Europa um, er hat Respekt – genauso wie mit den Wissenschaftlern, die er im Gegenwarts-Teil beschreibt. Das spätmittelalterliche Weltverständnis erscheint mitunter so fremd wie dasjenige der im Band beschriebenen Physik oder der Außerirdischen. Aber Flynn macht deutlich: Auch wenn uns die jeweiligen Denkansätze fremd sind, sind sie nicht minderwertig, sondern differenziert und sinnvoll, damals wie „heute“. Sie sind anders, weder besser, noch schlechter. Sie haben Interesse und Verständnis verdient.
Freilich: Damit ist der Roman zu komplex, um es beispielsweise mit einer „Wanderhure“ aufzunehmen. Letztlich ist er auf bizarre Weise gar ein Gegenentwurf zu Ockhams Rasiermesser. Immer wieder werden Erwartungen gebrochen – angefangen von den „menschlichen“ Außerirdischen, über die Tatsache, dass die beiden Wissenschaftler jeweils Fächer repräsentieren, die man gemeinhin eher dem jeweils anderen Geschlecht zutraut (theoretische Physik wird eher als ,männlich’ wahrgenommen, Geschichtestudierende sind überwiegend weiblich…). Selten verbindet ein Buch so viele verschiedene Themen und Forschungsgebiete, von der Anthropologie über die Epidemiologie, die Gesellschaftstheorie, Kosmologie, Quantentheorie, Religionspolitik, Soziologie und Sozialgeschichte, mittelalterliche Theologie bis zur Xenobiologie, um nur einige zu nennen. Gleichzeitig sind die Grenzen unseres (des?) Wissens ein zentrales Thema. Ist diese Komplexität der Grund, warum der Band bisher nicht in Deutschland erschienen ist? Diese Tatsache ist beschämend, nicht nur, weil die Geschichte in Deutschland spielt. Der Band wurde weltweit aufgenommen und es ist auch zu Übersetzungen in unsere Nachbarsprachen gekommen, ins Französische und ins Polnische, zudem beispielsweise ins Japanische – in Japan hat der Roman sogar einen nicht unbedeutenden Preis erhalten, ebenso wie in den USA, wo er es auf die Shortlist zum Hugo gebracht hat. Nur in Deutschland traut sich offenbar niemand an das Buch heran.
Vielleicht ist auch ein Grund, dass Michael Flynn als Science-Fiction-Autor wahrgenommen wird, und das Genre der Science-Fiction in Deutschland fast nur mit Computerspielen und den von ihrer Ästhetik beeinflussten Hollywood-Baller-Filmen assoziiert wird. Möglicherweise dominiert diese Assoziation so sehr, dass lediglich noch Leser zu Science-Fiction-Romanen greifen, die Nervenkitzel, Thrill suchen. Die Verlage, die Science-Fiction-Literatur verlegen, passen sich diesem Trend an (oder müssen sich ihm anpassen, da sie sonst zu wenig Umsatz erzielen?) – und so erwarten Interessenten ernsthafter, nachdenklicher Science-Fiction gar keine entsprechenden Werke mehr.
Offensichtlich war dies das Schicksal des einzigen Flynn-Bandes, der bisher in Deutschland erschienen ist („Der Fluss der Sterne“, erschienen 2008 bei Heyne in München, im Original 2003 unter dem Titel “The Wreck of the River of Stars“ ebenfalls bei Tor in New York veröffentlicht und von Andreas Brandhorst übersetzt). Auch dies ist ein eher ruhiges, reflektierendes Buch, aber der Verlag glaubte, Werbung für das Buch mit Sätzen wie „das größte aller Abenteuer beginnt […] – ein atemberaubendes Science-Fiction-Erlebnis“ machen zu müssen. Kein Wunder, dass die Leser, die auf der Suche nach Action waren, enttäuscht wurden, und andere Leser den Band gar nicht erst in die Hand nahmen. Kurz und gut, die Erwartungen wurden gegenseitig missachtet. So entstehen sich selbst verstärkende Schleifen: Niemand erwartet mehr seriöse, nachdenkliche Science-Fiction-Geschichten, und wenn dies doch mal vorkommen sollte, bekommen ihre potentiellen Leser dies gar nicht erst mit, weil in den einschlägigen Verlagsprogrammen anders vorherrscht – und die Action-Fans sind enttäuscht und schimpfen über den Verlag, falls sie ,fälschlicherweise’ ein solches Buch erwerben. Haben mithin Bücher wie Eifelheim überhaupt noch eine Chance in Deutschland?
Aber es gibt sie noch: ernsthafte Literatur, die sich großer Themen annimmt und diese atemberaubend und spannend aufbereitet. Wo die Spannung der Durchführung zu verdanken ist und nicht einer vordergründigen Action. ,Eifelheim’ ist ein solcher Roman und hätte eine Chance verdient. Immerhin kann man ihn ja heutzutage über die großen Lieferdienste in der amerikanischen Originalfassung schicken lassen, Gott sei Dank.
![]() von Alexander Karl
von Alexander Karl