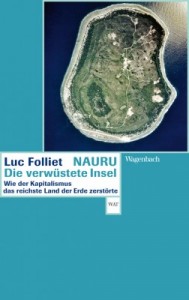- KOIDL, Roman Maria: Scheißkerle. Warum es immer die Falschen sind. Hoffmann und Campe, Hamburg 2010. ISBN: 978-3-455-50154-4.
Der vorliegende Titel hat in der Redaktion dermaßen polarisierte Reaktionen ausgelöst, dass wir uns – einmalig in der Geschichte des „besprochen“-Magazins – entschlossen haben, die unterschiedlichen Positionen in einem „Pro“ und einem „Kontra“ wiederzugeben.
KONTRA
von Daniela Nagorka
Bereits nach dem ersten Blick auf Cover und Titel von Roman Maria Koidls „Scheißkerle“ weiß man, was man in etwa von diesem Buch zu erwarten hat, nämlich Betrachtungen zur Verdrossenheit von Frauen gegenüber Männern, ironisches Klagen und Anekdoten über Probleme zwischen den Geschlechtern. Schon nach den ersten drei Seiten hat man dann die Gewissheit: Kein Klischee wird ausgelassen, jedes einzelne wird gnadenlos ausgeschlachtet und nervig zugespitzt. Allein das Cover bedient schon drei davon. Die Farbauswahl soll wohl eine Anspielung auf die kitschigen Vorlieben der Frau sein, der Frosch symbolisiert den (manchmal vorübergehend) verwunschenen Prinzen, den sich jede Frau wohl wünscht, und der Titel steht für das (Vor-)Urteil, dass Frauen die meisten bis alle Männer wegen zahlreicher Enttäuschungen einfach scheiße finden. Rein äußerlich lockt das Buch vermutlich tatsächlich mehr weibliche Leserinnen an.
Liest man sich dann doch ein wenig in den Stoff hinein, wirkt der Autor (zumindest auf die der vermutlich angesprochenen Zielgruppe zugehörigen Rezensentin) allerdings nicht unbedingt als Frauenversteher. Eher im Gegenteil: Einige könnten sich ein wenig veräppelt vorkommen. Einem Mann nimmt man das alles irgendwie nicht so ab, weil man sich fragt, ob er selbst überhaupt versteht, worüber er da schreibt. Diesen ganzen Ratschlägen, Erklärungen und Warnungen fehlt es an Überzeugungskraft und auch Ehrlichkeit, die vermutlich eher vorhanden wären, wenn das Buch eine Frau geschrieben hätte, die es nicht nur oberflächlich beurteilen kann, sondern aus dem Inneren, aus selbst erfahrenen Emotionen heraus.
Dieses Buch dient lediglich der Massenunterhaltung einer bestimmten Zielgruppe, nämlich den weiblichen „thirty somethings“ ohne Partner oder mit einem Exemplar Mann an ihrer Seite, das man eigentlich nie haben wollte. Somit eignet es sich zur Eigentherapie, die notgedrungen allerdings erfolglos bleiben wird – es sei denn, man schwört den Männern komplett ab – , denn der Autor selbst lässt kein gutes Haar an seinesgleichen. Er kann auch nicht umhin, die Single-Frau ab 30 als Unbelehrbare mit Helfersyndrom abzustempeln, die immer wieder an die falschen Männer gerät, also beispielsweise an solche, die sich nicht binden wollen und deshalb vorgeben, noch geschädigt und verletzt aus der vorherigen Beziehung zu kommen, oder solche, die eine Basis für ihre Lügen und Betrügereien schaffen, indem sie zunächst Mitleid erwecken.
Jedenfalls wird eine Frau, die auf Partnersuche ist oder in einer ernüchternden Beziehung steckt und sich an einigen Stellen des Buches wiederfindet, selbst mit einer riesigen Portion Galgenhumor und Selbstironie wahrscheinlich nicht über das Geschriebene schmunzeln können, sondern sich eher im Selbstmitleid baden, weil sie sich durch die Parallelen zu ihren eigenen Erfahrungen in ihrem Unglück auch noch bestätigt sieht. Welchen Zweck verfolgt also dieses Buch? Sollen enttäuschte Frauen etwa ihre allerletzten Hoffnungen begraben, doch noch einen beziehungswilligen und -fähigen Partner zu finden, einen Mann, der ehrlich zu lieben imstande ist?
Vielleicht eignet sich das Werk eher für Männer, die einmal wissen möchten, wie Frauen über sie denken, um über ihr Verhalten nachzudenken und die Frauen einfach mal mit Anderssein zu überraschen, damit sie nicht mehr nur ein Frosch unter vielen sind – falls er das überhaupt will. Der Autor unterstellt dem Großteil der Männerschaft nämlich Vorsätzlichkeit, wenn es um das Betrügen, Demütigen oder Manipulieren von Frauen geht, um mehrere von ihnen parallel beglücken zu können. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass solch strategisches Vorgehen tatsächlich von ihnen gesteuert wird, weil doch vom Autor häufiger betont wird, dass Männer eher einfach gestrickt und leicht zu durchschauen sind. Übrigens werden Frauen, die auf das betrügerische, sadistische Verhalten solcher Typen hereinfallen, vom Autor verständnisvoll als Opfer bezeichnet – analog zur Rechtsterminologie in Fällen von „seelischer Grausamkeit“.
Sicher mag es all diese Fälle geben, dennoch kann wohl niemand behaupten, dass Affären und Liebesbeziehungen allein aus permanenten Machtspielchen, Unterdrückung, Manipulation und Betrügereien bestehen. Gerade in den mittleren Kapiteln verliert das Buch diesbezüglich nämlich jegliche Komik und Ironie. Stattdessen werden ernst gemeinte Erklärungen in der Kindheit und der Erziehung gesucht. So seien beziehungsmissratenen Männern als Kind einfach keine Grenzen gesetzt worden. Und Frauen hätten in ihren Beziehungen noch immer unter Aufmerksamkeitsdefiziten und Verlustängsten zu leiden, wenn sie vom Vater nicht genügend beachtet wurden. Aha, so simpel ist das also. Und die passende Lösung hält der „Experte“ in seinem „Ratschlag-Katalog“ im Anhang unter der Nummer 17 auch bereit: Da helfe nämlich nur noch der Gang zum Psychologen.
War es nun wirklich nötig, dieses Buch zu schreiben? Sobald man sich in einer der darin geschilderten Situationen befindet, bestimmt meist sowieso das Herz über den Kopf. Man wird sich kaum an die Tipps in diesem Ratgeber erinnern, geschweige denn nach ihnen handeln.
Der Autor hat es sich etwas leicht gemacht: Er hat lediglich sämtliche Klischees, Vorurteile, Enttäuschungen, die jeder kennt und denen man täglich begegnet, gesammelt. Die verbitterten Reaktionen der von ihm interviewten Frauen auf seine Belehrungen hat er in teils gewollt lustige, teils schönsprachige Sätze verpackt. Hin und wieder findet man einen intelligent formulierten Satz, was aber nichts am mäßigen Gesamteindruck dieses Buches ändert. Man gewinnt keinerlei Mehrwert bei der Lektüre dieses Buches, außer vielleicht, der Leser ist ein Mann, der Nachhilfe in dem bekommen möchte, was seine Geschlechtsgenossen nach Meinung des Autors naturgemäß am besten können …
PRO
von Leif Allendorf
Es wird wohl kaum einen Leser geben, dem beim Lesen dieses Buches nicht auf Anhieb drei Personen im Bekanntenkreis einfallen, die exakt dem von Roman Maria Koidl beschriebenen Muster entsprechen. Gute Freundinnen, die an einem Partner festhalten, über dessen Benehmen ein halbwegs vernünftiger Mensch nur den Kopf schütteln kann, Bekannte, die verzweifelt darauf warten, „dass er sich noch meldet…“. Doch der Autor beschränkt sich glücklicherweise nicht darauf, einen Missstand zu thematisieren und zu beschreiben. Stattdessen geht er minutiös den Verhaltensstrukturen auf den Grund, die es möglich machen, dass kluge attraktive Frauen Mitte dreißig wertvolle Zeit, manchmal sogar Jahre damit verschwenden, einem Mann nachzulaufen, der dies offenbar nicht verdient.
Liebesbeziehungen rühren an den empfindlichsten und verletzlichsten Teil unseres Selbst. Eine Enttäuschung ist hier notwendig eine Katastrophe, ein Scheitern die totale persönliche Niederlage. Eine Bindung aufzubauen dauert Jahre, sie zu zerstören kann eine Sache von Minuten sein. Außerdem hat sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Zusammenleben nur zum kleineren Teil aus romantischen Momenten besteht – und beiderseits großer Geduld bedarf. Ist es da nicht angemessen, an einer Partnerschaft festzuhalten, auch wenn sie einer längeren Krise unterworfen wird?
Im Prinzip ja. Die Sache wird nur problematisch, wenn hier mit falschen Karten gespielt wird, wenn beispielsweise wie in Koidls Fallstudie die Frau ihrem Partner (oder Verehrer, oder verheiratetem Liebhaber) einen Vertrauenskredit einräumt, den dieser nicht im Traum zurückzuzahlen gedenkt, sondern im Gegenteil vorhat, das Konto so weit wie möglich zu überziehen und sich mit dem Gewinn aus dem Staub zu machen. Diese persönlichen Dramen nachvollziehbar zu machen, in diesen individuellen Schicksalen ganz simple objektiv nachvollziehbare Verdachtsmomente, Indizien und Beweise aufzuzeigen, mit Koidls Worten „Spiele aufdecken und sie beenden“: das ist das große Verdienst von „Scheißkerle“, einem Ratgeber, für den besonders spricht, dass er sich sehr skeptisch zu Ratgeberbüchern äußert.
Über weite Strecken gibt der Autor wider, welche Geschichten er sich von Frauen aus seinem Bekanntenkreis anhören musste und wie die Betroffenen ganz offensichtlich schreckliche Beziehungen schönredeten und auf eindeutig hoffnungslose Fälle setzten. Es folgt die Schilderung vergeblicher Versuche, mit logischen Argumenten das Netz aus Selbstbetrug zu zerreißen. Abschließend versucht Roman Maria Koidl, Erklärungen dafür zu finden, dass kritische Frauen ihre Kritikfähigkeit verlieren, vernünftige Menschen sich in völlig illusorischen Hoffnungen ergehen und Personen, die sich im Leben sonst sehr gut durchzusetzen wissen, sich plötzlich hin- und herschubsen lassen. Da ist der jedem Menschen innewohnende Wunsch, geliebt zu werden und die Angst, einsam zu werden und zu bleiben. In extremen Fällen hat eine verkorkste Beziehung zum Vater die Tochter so sehr geschädigt, dass sie sich unbewusst in aussichtslose Partnerschaften einlässt, um sich in ihrer Verbitterung bestätigt zu sehen.
Natürlich hat Koidls Sammlung von Fallstudien auch Schwächen. So gehört die Vorstellung, dass Männer nur „das eine“ wollen, während es Frauen nur um „das Gefühl“ geht, in die Mottenkiste. Auch die wiederholte Beteuerung, Frauen seien eh die besseren Menschen, bewegt sich irgendwo zwischen Galanterie und Schleimerei. Entscheidend ist, dass Koidl ein nobles Ziel verfolgt: Die Tricks und Kniffe der „Scheißkerle“ kann er als Mann unbefangen öffentlich machen. Würde eine Frau dies tun, so hätte es einen faden Beigeschmack. Und damit erweist Koidl sich wirklich als Kavalier.
![]() von Maria Shilik
von Maria Shilik